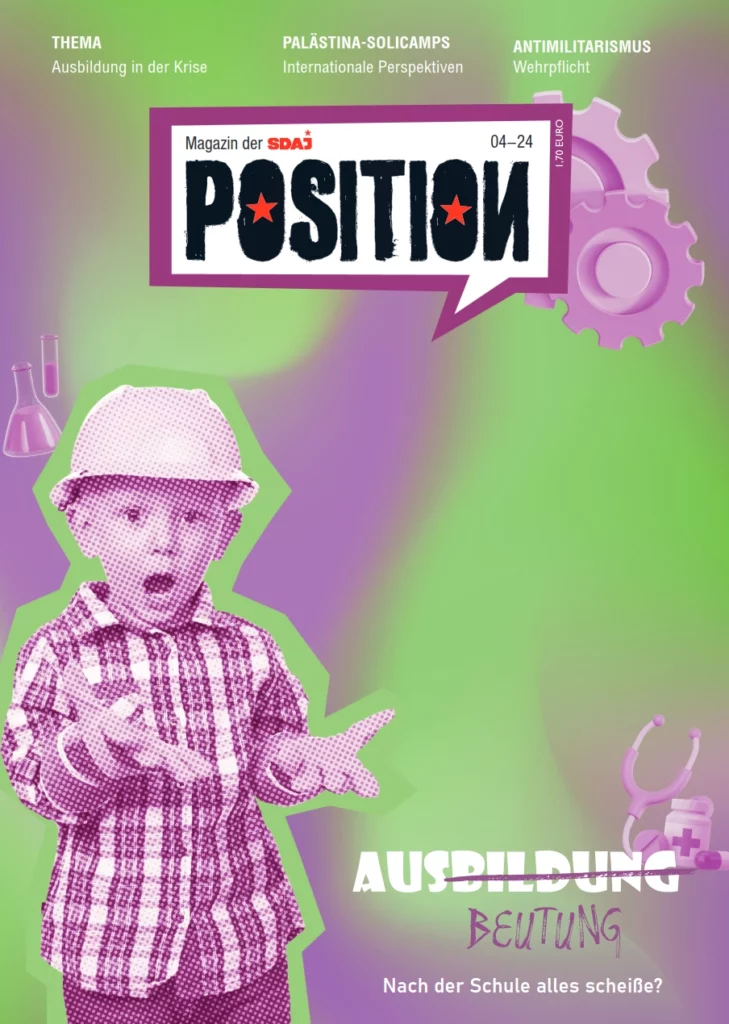In der DDR herrschten die arbeitenden Menschen – mit aller Verantwortung und mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt.
Der Sozialismus ist eine Servicewüste. Unfreundliche Verkäuferinnen, chaotische Hotels und faule Kellner ziehen sich wie ein roter Faden durch die Berichte von Besuchern aus den westlichen Ländern im „Ostblock“. Natürlich kamen diese Besucher häufig mit dem Auftrag, zu beweisen, dass in der „Zone“ nichts richtig funktionierte, dass eine Wirtschaft ohne Unternehmer nicht funktionieren kann. Aber etwas ist schon dran an diesen Beobachtungen. Wir sind daran gewöhnt, dass der „Kunde König“ ist. Wer Geld hat, kann erwarten, ohne Widerrede bedient zu werden. Ein Verkäufer oder eine Kellnerin müssen manchmal auch mit den dümmsten und arrogantesten Vorwürfen klarkommen, ohne dass sie dem „König Kunden“ die Meinung sagen können.
Keine Angst
In der DDR war das anders. Das hieß, dass manchmal der Service nicht so reibungslos lief, dass das Lächeln der Bedienung nicht so glatt war, dass eben der Kunde sich nicht als König fühlen konnte, nur weil er oder sie genügend Geld in der Tasche hatte. Daran zeigte sich aber auch etwas, was das Leben in der DDR prägte, was die Haltung der Menschen bis in den alltäglichsten Handgriff beeinflusste: Die Menschen hatten keine Angst davor, ihren Job zu verlieren. In ihrem Land gab es keine Arbeitslosen, und kein Chef konnte einen Mitarbeiter so einfach auf die Straße setzen. „Das war ein Ausdruck von Freiheit“, so die Journalistin Claudia Wangerin, „auch wenn es für den, der eine missgelaunte Verkäuferin antraf, eben kein freundliches Lächeln bedeutete.“
Wessen Freiheit?
Dianas Mutter ist Fleischwarenfachverkäuferin. Sie ist nach der „Wende“ nicht sofort entlassen worden, sie hatte Glück. Entlassen worden ist sie erst, als sie ihrem Chef einmal klarmachte, dass seine Arbeitsorganisation unsinnig ist – „so kennt sie das halt aus der DDR“, erzählt Diana. Aber in unserer Gesellschaft, in der Marktwirtschaft der Bundesrepublik, ist es nicht vorgesehen, dass sich die Beschäftigten zu sehr einmischen in die Art und Weise, wie die Arbeit gemacht wird. Wir haben unsere Betriebsräte, wir haben unsere Gewerkschaften, wir haben das Recht auf „Mitbestimmung“. Aber diese „Mitbestimmung“ hat eine klare Grenze. Was wird produziert? Auf welche Weise wird gearbeitet? Für welche Kunden arbeitet das Unternehmen? Zu welchem Preis wird eine Dienstleistung angeboten? Bei diesen Entscheidungen gibt es keine Mitbestimmung. Denn der Unternehmer darf zwar nicht alles mit uns machen. Aber seine „unternehmerische Freiheit“, sein Recht, mit dem Betrieb, der ihm gehört, zu machen, was er für richtig hält, bleiben dabei immer gesichert. Die Freiheit des Unternehmers und die Freiheit des Mitarbeiters sind zwei verschiedene Dinge.
Wende im Selbstbewusstsein
Wenn wir etwas über die DDR hören, dann geht es meist um die Freiheit, die es dort nicht gab. Mit der DDR verbinden wir die merkwürdigen Bilder von Paraden, bei denen alte Männer von der Tribüne winken, die seltsame Sprache aus den Verlautbarungen der Partei und dass dort vieles so anders, so altbacken und so viel weniger modern wirkte als im Westen. Aber wenn wir verstehen wollen, was die DDR war, dann müssen wir versuchen, zu sehen, was hinter diesem DDR-Look stand, was das Leben dort ausmachte. Walter Schmidt, heute Rentner, hat den Unterschied zwischen Ost und West, zwischen Sozialismus und Kapitalismus, an seinem Arbeitsplatz im Chemiekombinat Bitterfeld (CBK) erlebt. Er war Wirtschaftssekretär der SED im Kombinat, aber dann, nach der „Wende“, im Januar 1990, wurde er von seinem Posten entfernt, weil er den Übergang in die Marktwirtschaft nicht ohne Widerspruch hinnehmen wollte. Nun arbeitete er in der Produktion des riesigen Chemiebetriebs, und auch hier diskutierte er mit seinen Kollegen über die Zukunft. „Ich habe gesagt, es vergeht kein Jahr mehr, dann ist hier alles dicht. Dann vernichtet der Gegner das ganze Kombinat.“ Diese Ungewissheit darüber, wie es weitergeht am eigenen Arbeitsplatz, das war für viele DDR-Bürger eine der ersten Erfahrungen in der neu gewonnenen „Freiheit“. „Ich habe die Leute nicht wieder erkannt, wie die sich auf einmal duckten, wie die willfährig die Anweisungen des Direktors und des Meisters erfüllten“, erzählt Schmidt. „So ein Wandlungsprozess innerhalb weniger Wochen, das hätte ich nie für möglich gehalten.“
Weil sie es besser wussten
Denn noch kurz zuvor, vor der „Wende“ von 1989, hatten die Kolleginnen und Kollegen eine andere Haltung. „Es war selbstverständlich, dass die Arbeiter ganz selbstbewusst auftraten“, erinnert sich Walter Schmidt. „Wenn was nicht stimmte, dann holten sie die Partei oder die Gewerkschaftsleitung. Dann sind sie aufmüpfig geworden – aber nicht einfach so, sondern weil sie es besser wussten. Sie hatten ja auch eine ganz solide fachliche Ausbildung.“ Auch Diana weiß von ihrer Mutter, dass die Arbeit in der DDR anders war: „Sie hat mir erzählt, dass sie damals im Konsum miteinander besprochen haben, wie man die Arbeit machen muss, sie haben das kollegial organisiert. Natürlich gab es da auch einen Chef, aber der hat dann gefragt: Mädels, was denkt ihr darüber? Und dann haben sie zusammen entschieden. Das war dann mit der Wende vorbei.“
Nicht vereinbar
Dieses Selbstbewusstsein, dieser Stolz der arbeitenden Menschen konnten die „Wende“ nicht überleben. Wer von seinem Chef herumkommandiert wird, wer bei einem Vorstellungsgespräch darum bitten muss, für einen anderen arbeiten zu dürfen, wer arbeitslos zu Hause sitzt, weil er keinen Job findet, hat es schwer, ein solches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Die zwei Arten der Freiheit – die Freiheit des Unternehmers und die Freiheit der arbeitenden Menschen – schließen einander aus. Sie stehen für zwei verschiedene Entwicklungswege, für zwei verschiedene Gesellschaftssysteme. Nach dem zweiten Weltkrieg stand ganz Deutschland vor der Frage, welchen dieser beiden Wege es einschlagen sollte.
Verlorene Ostwerte
Die Chemiebetriebe in Bitterfeld, in denen Walter Schmidt tätig war, waren vorher ein Teil der IG Farben gewesen, dem riesigen Chemiekonzern, der seit den 20er Jahren die gesamte deutsche Chemiebranche kontrollierte, der Hitler zur Macht verhalf und der zu den größten Profiteuren von Massenmord und Krieg gehörte. Dieser Konzern produzierte das Zyklon B für den industriellen Massenmord, er lieferte viele Produkte, die notwendig waren für den Eroberungskrieg der Faschisten. 1945 übernahm die Sowjetunion die Betriebe in Bitterfeld, sowohl ein Teil der Produkte als auch ein Teil der Maschinen wurden als Wiedergutmachung für den Krieg in die Sowjetunion gebracht. Nun ging es darum, die Produktion wieder zum Laufen zu bringen und für den Bedarf der Bevölkerung zu produzieren, nicht für die Eroberungspolitik der Nazis. 1954 übergab die Sowjetunion diese Betriebe an die DDR, von da an waren auch die Chemiewerke in Bitterfeld ein Volkseigener Betrieb. So oder ähnlich war es in der ganzen DDR. Die Herren der Konzerne waren nach dem Krieg zunächst weg, es waren die Arbeiter, die die Trümmer wegräumten und die Produktion wieder in Gang brachten. 1946 entschieden sich 77 Prozent der Wahlberechtigten in Sachsen in einem Volksentscheid dafür, die Betriebe der aktiven Nazis und Kriegsverbrecher, die Werke der großen Monopole zu enteignen. Auch die Großgrundbesitzer, die Junker, die in der deutschen Geschichte eine besonders reaktionäre Rolle gespielt hatten, wurden enteignet. Landarbeiter, kleine Bauern, Umsiedler aus den ehemaligen deutschen Gebieten z.B. in Polen erhielten ein Stück Land. Diese Entscheidungen waren Vorbild für die ganze sowjetische Zone, aber sie blieben nicht ohne Widerstand. Die Großunternehmen, die im Osten enteignet worden waren, konnten im Westen weiter bestehen. Die Verluste, die ihnen die Enteignung brachte, tauchten als „verlorene Ostwerte“ in den Bilanzen auf und wurden an den Börsen gehandelt, und die Konzernherren setzten alles daran, um diese „Ostwerte“ wieder in ihren Besitz zu bringen. 1989 hatten sie damit Erfolg.
Politische Voraussetzungen
Um eine neue Gesellschaft aufzubauen, war deshalb mehr nötig, als nur die Wirtschaft neu zu organisieren. Die Enteignung der Konzerne hatte politische Voraussetzungen. 1946 vereinigten sich in der „Zone“ die beiden Arbeiterparteien SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Sie zogen die Lehre aus der Vergangenheit: Damit die Arbeiterklasse selbst bestimmen kann, braucht sie eine einige Arbeiterpartei, eine Partei, die sich den Aufbau einer neuen wirtschaftlichen Ordnung und einer neuen politischen Macht zum Ziel setzt. Auch im Staat übernahmen neue Kräfte die wichtigen Positionen: In der späteren DDR waren ehemalige KZ-Häftlinge Minister, ehemalige Wehrmachts-Deserteure Generäle, ehemalige Spanienkämpfer Polizeipräsidenten.
„Elitenwechsel“
Dazu gehörte auch, das Bildungswesen völlig neu zu organisieren. Erika Baum gehörte zu denjenigen, die die alten Nazilehrer ersetzten und eine antifaschistische, demokratische Schule ermöglichten, eine Schule, die gerade auch Kindern und Jugendlichen aus Arbeiter- und Bauernfamilien den Zugang zu einer umfassenden Bildung eröffnet. Sie kam aus einer Wiener kommunistischen Arbeiterfamilie und hatte sich als junge Frau am Widerstand gegen Hitler beteiligt. Ihr späterer Mann Bruno Baum war als Kommunist in Auschwitz eingesperrt und hatte selbst dort an der Organisierung des illegalen Widerstands gearbeitet. Von dort war er in das österreichische KZ Mauthausen gebracht worden, nach der Befreiung lernten sich beide in Wien kennen. Wer verstehen will, was die DDR war, der sollte sich auch fragen, was sie für solche Menschen bedeutete: Im einen Teil Deutschlands behielten die alten Nazis, die Juristen, Generäle und Professoren Hitlers die wichtigen Funktionen. Im anderen Teil wurden sie ersetzt – „Elitenwechsel“ nennt das der bürgerliche Historiker Arnd Bauerkämper.
Selbst die Kräfte anspannen
Die Monopole und die Junker waren enteignet, das Bildungsprivileg der alten Eliten gebrochen, ein neuer, demokratischer Staat aufgebaut. Dieser Staat setzte sein Vertrauen in die Arbeiterschaft, die die Betriebe wieder zum Laufen gebracht hatte, in die Antifaschisten, die aus Illegalität und KZ kamen, in die armen Bauern, die nun ein Stück Land besaßen, in die Intellektuellen, die sich von überkommenen Vorstellungen lösten. Der Wiederaufbau im Westen stützte sich auf ganz andere Kräfte – auf das deutsche Kapital und auf US-amerikanische Kredite aus dem Marshall-Plan. Die SED erklärte dazu: „Der Aufbau der deutschen Industrie mit Hilfe amerikanischer Anleihen darf nicht dazu dienen, deutschen Monopolherren die Gelegenheit zu geben, die Industrie erneut zu Kriegszwecken zu missbrauchen. Das deutsche Volk muss selbst seine eigenen Kräfte anspannen, um die friedlichen Zwecken dienende Wirtschaft aufzubauen.“ Vertrauen in die eigene Kraft, oder Vertrauen darauf, dass kapitalistische Unternehmer und ausländisches Geld die Lösung bringen – vor dieser Entscheidung stand Deutschland, und die beiden Teile unseres Landes gingen unterschiedliche Wege.
Wissen als Waffe
Aber dieses Vertrauen in die eigenen Kräfte hieß auch, von jedem einzelnen zu erwarten, Verantwortung zu übernehmen, dazuzulernen, und zwar schnell. Wie Walter Schmidt, der aus einer armen Bauernfamilie kam und eine Schlosserlehre machte. Später bekam er die Möglichkeit, an einem Meisterlehrgang teilzunehmen – neben dem Beruf. Wie Erika Baum, die gerade nach Berlin gekommen war, schon als Schulhelferin Kinder unterrichtete und nachmittags selbst lernte. Wie die Studierenden der Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF), die Erika Ende der 50er unterrichtete. An den ABF sollten sich junge Menschen aus Arbeiter- und Bauernfamilien auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Aber sie sollten keine Akademiker im traditionellen Sinne werden, sie sollten sich nicht von der Arbeiterklasse entfernen, sie sollten fachliche Qualifikation mit politischem Bewusstsein verbinden. Für diese Studierenden war das Lernen ein Teil des Klassenkampfes. Die Seminargruppe, die Erika leitete, stellte die Losung auf: „Jede eins ein Schlag gegen Adenauer!“ Vielleicht finden wir das heute merkwürdig und engstirnig, aber die Logik dahinter ist einfach: Das Wissen, dass sie sich an der ABF aneigneten, war eine Waffe im Kampf gegen den Imperialismus, ein Werkzeug zum Aufbau einer neuen Ordnung. Über diese Menschen sagte der Dichter Bertolt Brecht, sie seien Intellektuelle, die „nicht aus, sondern mit dem Proletariat aufgestiegen sind.“ Es ging um die Herausbildung einer neuen, sozialistischen Intelligenz – denn „die ganzen Akademiker vor uns“, so Erika Baum, „hatten sich ja auf das Heftigste blamiert mit ihrer Anhängerschaft oder ihrer Duldung der Nazis.“
Ausnahme und Regel
Die SED und die Regierung haben diese Aufforderung an die Masse der Bevölkerung, selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, nicht immer durchgehalten. Das müssen wir kritisieren, aber wir dürfen nicht den Zusammenhang vergessen: Die Unternehmer und die Regierung aus dem Westen lauerten auf jede Gelegenheit, um das andere Deutschland wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen. Es gab Ausnahmen von der Regel, dass der Sozialismus eine höhere Form der Demokratie hervorbringt, und zwar viel zu viele. Denn der Sozialismus garantiert nicht, dass keine Fehler gemacht werden – aber er schafft die Möglichkeit, solche Fehler zu korrigieren, eine Möglichkeit, die wir im Kapitalismus nicht haben. Denn Krise und Krieg, Armut und Arbeitslosigkeit sind. im Kapitalismus keine Fehler, sondern Teil des Systems.
Nichts Besonderes
Im Sozialismus haben andere Dinge System: z.B. eben qualifizierte Bildung und Ausbildung für jeden. Darum produzierte das Bildungssystem der DDR keine Sackgassen, denn der Sozialismus ist auf gebildete Menschen angewiesen. Die Biographien vieler DDR-Bürger erzählen davon, wie junge Männer und Frauen aus einfachen, oft wenig gebildeten Familien sich zu verantwortlichen Positionen qualifizierten. Walter Schmidt war erst Schlosser, dann Wirtschaftssekretär der SED in einem Kombinat mit 18.000 Beschäftigten. „Das war nicht die Ausnahme. Das kannst du überall beobachten, dass in der DDR die Abeiter- und Bauernkinder sehr gefördert worden sind und sogar bevorzugt worden sind. Aber die fachlichen und gesellschaftlichen Qualifikationen mussten nachgewiesen werden, ohne die ging das nicht.“ Auch für Erika Baum war ihre Entwicklung nichts Besonderes. „Wir waren ja eine große Zahl von Leuten, die eine ähnliche Entwicklung gemacht haben – Gott, was haben wir alles gelernt, was ich alles lernen musste! Das war ja eine Zeit, in der ungeheure, grundlegende Veränderungen im Denken vor sich gingen und organisiert werden mussten.“
Ein anderes Wirtschaftswunder
Dass die arbeitenden Menschen lernen und Verantwortung übernehmen war in der DDR nicht die Ausnahme. 1972 nahmen 25 Prozent aller Berufstätigen an einer organisierten Form der Weiterbildung teil, genau so viele reichten so genannte „Neuerervorschläge“ ein, Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit, der Qualität, der betrieblichen Abläufe usw. Diese Verantwortung war die Grundlage für das Selbstbewusstsein der Menschen in der DDR. Schön war deshalb noch lange nicht alles. Der Staat wollte, dass seine Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten, sich bilden und außerdem am besten noch an den Versammlungen der Gewerkschaft, der FDJ, der SED und anderer Organisationen teilnehmen. Das Vertrauen in die Arbeiterklasse konnte auch dazu führen, dass unrealistische Erwartungen gestellt wurden. Und das Selbstbewusstsein der Beschäftigten musste noch nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Arbeit lief. Aber eine solche Gesellschaft, in der sich die arbeitenden Menschen nach ihren Fähigkeiten einbringen, in der sie ihre Fähigkeiten jeden Tag weiterentwickeln, die kann auch in der Wirtschaft Erfolge erzielen, an die im Kapitalismus nicht zu denken ist. 1967 gab die Wochenzeitung Die Zeit einem Artikel über die DDR die Überschrift: „Wirtschaftswunder auf sozialistisch“. Solche Erfolge stellen sich nicht von selbst ein, auch sie hängen eben von den arbeitenden Menschen ab. Aber wer im Sozialismus nur eine Servicewüste sieht, der wird kaum verstehen, was die DDR für ihre Bürgerinnen und Bürger bedeutet hat.
Olaf, Frankfurt
Dem ist nicht zu helfen
Robert Iswall, Hauptfigur im Roman „Die Aula“ von Hermann Kant, soll eine Rede vor ehemaligen Studierenden der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät halten. Dabei macht er deutlich, was die DDR für den Einzelnen bedeutete.
„Steh auf, sag deinen Namen und sag deinen Beruf, den von damals und den von heute, und dann setz dich wieder, denn das ist alles. Alles, was wir brauchen, sind Tatsachen. Und nun steht auf, ihr Tatsachen, und laßt euch sehen! Irmgard Strauch, Verkäuferin – Studienrätin; Joachim Trimborn, Fischer – Chemiker; Rose Paal, Landarbeiterin – Sinologin; Vera Bilfert, Schneiderin – Augenärztin. Der nächste: Landarbeiter, Chirurg, Dr. med. habil., Verdienter Arzt des Volkes; Waldarbeiter – Hauptabteilungsleiter im Ministerium für Land- und Forstwesen, Diplom-Forstwirt. Die anderen brauchen nicht mehr aufzustehen, immer das gleiche: Ziegeleiarbeiter – Cheftechnologe; Färberin – Staatsanwältin, ein Spezialist für Oberflächenhärtung, der Maurer war, ein Radiologe, der Steinsetzer gelernt hat, und so fort, immer das gleiche, ist ja langweilig. Wer jetzt noch nicht ahnt, was dies hier für ein Haufen ist, wer jetzt noch nicht sieht, was das war, ABF, wer jetzt noch nicht weiß, was das ist, DDR, der kann einem nur leid tun, dem ist nicht zu helfen“.
Eins überbraten
Erika Baum (89) über das Selbstbewusstsein der Menschen in der DDR
„Das Leben im Sozialismus hat die Menschen in bestimmten Bereichen selbstbewusster gemacht – das ist besonders bei Frauen zu beobachten, auch in der Partnerschaft. Wobei ich sagen muss, dass in den letzten zwanzig Jahren viel verloren gegangen ist. Die Bedingungen ihres Lebens haben sie selbstbewusst gemacht, weil sie nicht unterdrückt waren, weil sie den Vorgesetzten eins überbraten konnten, keine Angst um den Arbeitsplatz hatten.“